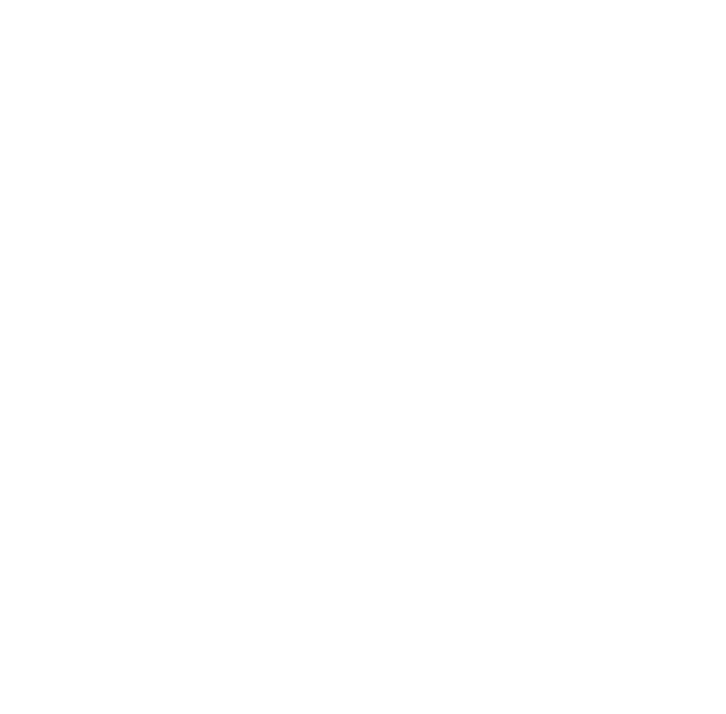Die Zukunft der CSR: Welche Trends werden die gesellschaftliche Verantwortung prägen?
Wie sieht die Zukunft der Corporate Social Responsibility aus und auf welche Veränderungen müssen sich Unternehmen einstellen? Mehr dazu in diesem Beitrag.
Jede unternehmerische Tätigkeit hat Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft. Sich diese bewusst zu machen und seine Handlungen nachhaltiger auszurichten, ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Entsprechende Fragestellungen werden unter dem Begriff der Corporate Social Responsibility (CSR) zusammengefasst. Deren Betrachtung ist heute wichtiger denn je, weil wirtschaftliches Handeln global verflochten stattfindet. Lieferketten erweisen sich gerade für größere Unternehmen als komplex und es gestaltet sich schwierig, allen sozialen, ökologischen und organisatorischen Anforderungen zusätzlich zu den rein wirtschaftlichen zu genügen. CSR ist daher kein Luxus mehr, sondern eine Notwendigkeit für Organisationen, die ihren geschäftlichen Erfolg in einem zunehmend schwierigen Umfeld absichern möchten.
Welche Bedeutung hat die Kreislaufwirtschaft für CSR?
Die soziale Verantwortung der Unternehmen und die Kreislaufwirtschaft sind gleichermaßen für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung von Bedeutung. Denn beide haben das Potenzial, die Nachhaltigkeit auf Organisationsebene zu stärken und damit eine dauerhafte und ganzheitliche Unternehmensentwicklung voranzutreiben. Zu den verschiedenen Maßnahmen der CSR gehören zum Beispiel eine faire Einkommensverteilung, die Etablierung einer mitarbeiterorientierten Unternehmenspolitik oder der sparsame Umgang mit natürlichen Ressourcen.
Die Frage ist also, welchen Beitrag Unternehmen zu einem nachhaltigen Wirtschaften leisten können. Zu den Kernprinzipien der Kreislaufwirtschaft wiederum gehört es, Abfälle und Verschmutzung zu vermeiden, die Lebensdauer von Materialien und Produkten zu maximieren und natürliche Systeme zu regenerieren. Es ist daher offensichtlich, dass gerade beim Umgang mit natürlichen Ressourcen Schnittpunkte zwischen CSR und der Kreislaufwirtschaft bestehen. Was folgt daraus? Setzt Ihr Betrieb sich für die Kreislaufwirtschaft ein und führt kreislauforientierte Produktions- und Entsorgungsprozesse ein, leistet es damit automatisch einen großen Beitrag für das CSR-Engagement.
Erweiterte Produzentenverantwortung
Dabei sind in der Kreislaufwirtschaft einige interessante Trends zu erkennen. Zu nennen ist zum Beispiel die erweiterte Produzenten- oder Herstellerverantwortung (EPR). Vereinfacht gesagt sind Unternehmen zunehmend verantwortlich für die Entsorgung ihrer eigenen Produkte. Sie führen zum einen Recyclingprogramme ein, bauen Rücknahmesysteme auf und entwickeln Produkte, die von vornherein auf Langlebigkeit und eine einfache Reparatur ausgelegt sind. Zum anderen nutzen sie verstärkt die Möglichkeiten, welche die Digitalisierung für die Optimierung des Kreislaufs bietet.
Kreislaufwirtschaft und Daten
Hier spielen der Umgang mit Daten und moderne Technologien wie das Internet der Dinge (IoT) eine entscheidende Rolle. Die Hersteller erhalten damit die Möglichkeit, ihre Produkte während des Lebenszyklus besser nachzuverfolgen. Lieferketten lassen sich optimieren, Recyclingprozesse automatisieren und Abfälle minimieren. Wer soziale Verantwortung übernehmen möchte, muss also die Systeme und Prozesse einrichten, die erforderlich sind, um das Potenzial seiner Daten im Sinne der Nachhaltigkeit voll auszuschöpfen. Daher ist eine Stärkung der CSR in der Regel auch mit entsprechenden Investitionen etwa in die IT-Infrastruktur verbunden.
Wie tragen nachhaltige Lieferketten zur Unternehmensverantwortung bei?
Zwischen der CSR und der Gestaltung nachhaltiger Lieferketten besteht ein enger Zusammenhang. Eine verantwortungsvolle Unternehmensführung beginnt damit, wie Sie Ihre Rohstoffe beschaffen und wie Sie die dafür erforderlichen Lieferketten aufbauen. Nachhaltige Lieferketten lassen sich als Kernbestandteil der CSR ansehen. Im Fokus stehen Fragen wie diese:
- Wie können wir Produkte und Materialien verantwortungsvoll beschaffen?
- Wie kann ich negative Auswirkungen auf die Umwelt und Menschen bzw. die Gesellschaft minimieren?
- Wie kann meine Organisation allen gesetzlichen Anforderungen entsprechen?
Der letzte Punkt erhält in Europa wegen des Lieferkettengesetzes natürlich ein besonderes Gewicht. Es verpflichtet Unternehmen dazu, entlang der gesamten Lieferkette hohe soziale und ökologische Standards einzuhalten. Bei Zulieferern und in deren Heimatländern soll es nicht zu Umweltzerstörung, Kinderarbeit oder Menschenrechtsverletzungen kommen. Der Gesetzgeber fordert ein hohes Maß an Transparenz und Risikominimierung. Es können daher Audits und Schulungen der Lieferanten erforderlich sein, um hier allen Anforderungen zu genügen. Daraus können ein hoher Verwaltungsaufwand und Kosten resultieren, gleichzeitig soll sich dadurch aber auch die Resilienz erhöhen lassen. Im Idealfall kann das Lieferkettengesetz dabei helfen, eine nachhaltigere und ethischere Unternehmenspraxis umzusetzen.
Herausforderungen einer nachhaltigen Lieferkette
Im Zusammenhang mit den Lieferketten sind eine ganze Reihe von Herausforderungen zu meistern. Ihr Unternehmen benötigt zum Beispiel tiefere Einblicke in die Lieferkette. Das gilt gerade für Sublieferanten und Zwischenhändler. Für eine höhere Transparenz und bessere Rückverfolgbarkeit können digitale Lieferkettenmanagement-Tools sorgen. Um Nachhaltigkeit zu gewährleisten, können auch Zertifizierungen wie Fair Trade oder FSC sowie Bio-Zertifikate nützlich sein. Zudem ist grundsätzlich eine engere Zusammenarbeit mit den Lieferanten erforderlich, als das bisher häufig der Fall war. Hier können neben Schulungen und dem Eingehen langfristiger Verträge auch finanzielle Unterstützungen sinnvoll sein.
Wie wirken sich nachhaltige Lieferketten auf die Kostenstruktur aus?
Es ist gerade in Hinblick auf nachhaltige Lieferketten ersichtlich, dass die Stärkung der CSR erhebliche Kosten verursachen kann. Der Vorteil besteht jedoch darin, dass Ihr Unternehmen damit seine Reputation verbessern und sich vom Wettbewerb abheben kann. Mit einer CSR-orientierten Lieferkette geht auch eine Risikominderung einher, weil Umweltskandale oder Menschenrechtsverletzungen Ihre Unternehmung nicht mehr so leicht schädigen können. Zudem beugen Sie Schwankungen in der Rohstoffversorgung vor.
Welche Rolle spielt die regenerative Landwirtschaft?
Wie kann ich die negativen Auswirkungen meiner geschäftlichen Aktivität auf die Umwelt begrenzen? Mit dieser Frage beschäftigen sich die CSR und die regenerative Landwirtschaft gleichermaßen. Die regenerative Landwirtschaft ist dabei nicht nur ein beliebiger weiterer Nachhaltigkeitsansatz. Sie zielt vielmehr darauf ab, Böden und Ökosysteme aktiv zu verbessern. Dabei kommen verschiedene Methoden zum Einsatz wie etwa der Humusaufbau oder die Bodenverbesserung. Ebenfalls wichtig sind die Förderung der Biodiversität und der Schutz des Wasserhaushalts. Wenn es Ihrem Unternehmen gelingt, die regenerative Landwirtschaft in die umfassendere CSR-Strategie zu integrieren, ergeben sich daraus vielfältige Vorteile. Diese sind zum einen ökologischer Natur:
- Nutzung nachhaltiger Rohstoffquellen: Wer sich von endlichen Ressourcen unabhängiger macht, gestaltet seine Lieferketten resilienter und verbessert deren Stabilität.
- Mehr Artenvielfalt: Zu den Anliegen der CSR gehört die Erhaltung der Ökosysteme bzw. deren Wiederherstellung. Erreichen lässt sich das zum Beispiel durch die Schaffung zusätzlicher Lebensräume für Tiere. Hier ergeben sich Synergien mit der regenerativen Landwirtschaft, weil diese der Entstehung von Monokulturen entgegenwirkt.
- Besserer Klimaschutz: Maßnahmen der regenerativen Landwirtschaft wie etwa der Humusaufbau helfen bei der Bindung von Kohlenstoff im Boden. Damit können Unternehmen aktiv dazu beitragen, Treibhausgase zu reduzieren.
Neben diesen ökologischen Vorteilen sind auch soziale Verbesserungen zu betrachten. Dazu gehören zum Beispiel die Stärkung des Konsumentenvertrauens und der Markentreue. Wer ethische Praktiken unterstützt, kann Kunden eher zum Kauf seiner Produkte bewegen. Entscheidet sich Ihr Unternehmen für regenerativ agierende Landwirte, stellen Sie damit unter Beweis, dass Sie Verantwortung möglichst für die gesamte Wertschöpfungskette übernehmen und dass Sie ländliche Gemeinschaften und Regionen unterstützen möchten.
Zu den wirtschaftlichen Vorteilen der regenerativen Landwirtschaft gehören Verbesserungen auf der Kostenseite, weil Sie zum Beispiel weniger synthetische Dünger einkaufen müssen. Durch eine Optimierung der Bodenqualität lässt sich zudem eine längere Bodenfruchtbarkeit erreichen. Weiterhin können Sie durch die Betonung der Nutzung regenerativer und nachhaltiger Quellen Ihr Image stärken, ein innovatives Unternehmen zu sein. Dadurch lassen sich eventuell ganz neue Käuferschichten erschließen, die für ökologische und soziale Fragen besonders sensibel sind.
Wie verhalten sich soziale Innovationen und unternehmerische Verantwortung zueinander?
Wenn sich ein Unternehmen im Bereich CSR einsetzt, strebt es aktiv gesellschaftliche Problemlösungen an. Die soziale Verantwortung wird als strategische Herausforderung verstanden, deren Bewältigung neue Ansätze erforderlich macht. Hier kommen die sogenannten sozialen Innovationen ins Spiel. Hierzu gehören alle Dienstleistungen, Produkte, Organisationsmodelle oder Ideen, die zur Bewältigung gesellschaftlicher Probleme einen Beitrag leisten können. An dieser Stelle ist eine Abgrenzung von den technischen Innovationen erforderlich, die Produkte, Dienstleistungen oder Werkzeuge mit neuen Funktionen umfassen. Die sozialen Innovationen zielen hingegen auf soziale Mehrwerte ab und sollen Positives für die Gemeinschaft bewirken. Doch wie kann das in der Praxis konkret aussehen? Das sind einige Beispiele für soziale Innovationen, mit deren Hilfe sich die CSR stärken lässt:
Soziale Inklusion: Unternehmen können Bildungsprogramme aufsetzen und die berufliche Weiterentwicklung fördern, um benachteiligten Bevölkerungsgruppen einen besseren Zugang zu Wissen, Ressourcen und Technologien zu verschaffen. So könnten Sie zum Beispiel digitale Lernplattformen bereitstellen, um den Wissenstransfer und damit die Integration in den Arbeitsmarkt zu beschleunigen.
Bessere Gesundheitsversorgung: Zu den sozialen Innovationen gehört es auch, dass sich Unternehmen bemühen, das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern. Als Beispiel dient hier der Einsatz mobiler Gesundheitsdienste in benachteiligten Regionen der Welt. Allgemein können Firmen sich dafür engagieren, den Zugang zu einer modernen Gesundheitsversorgung zu erleichtern.
Förderung nachhaltiger Entwicklungspraktiken: Unternehmen stärken das Bewusstsein für die Notwendigkeit des Umweltschutzes, indem sie entsprechende Initiativen unterstützen. Dazu gehören die Nutzung erneuerbarer Energiequellen oder die Reparatur und Aufbereitung gebrauchter Kleidung. Viele dieser Initiativen zielen auch auf eine Förderung der oben bereits erwähnten Kreislaufwirtschaft ab.
Allgemein demonstrieren soziale Innovationen den Stakeholdern auf überzeugende Weise, dass ein Unternehmen Verantwortung übernehmen möchte. Wer sich mit den sozialen Werten seines Arbeitgebers identifizieren kann, zeigt auch eine geringere Wechselneigung, was in Hinblick auf die Fachkräftesicherung besonders wichtig ist.
Welche Trends und Technologien haben das Potenzial, CSR zu verändern?
Es bleibt jedem Unternehmen selbst überlassen, wie es seine CSR-Strategie umsetzt. Trends sind jedoch identifizierbar, wie Organisationen aktuell mit dieser Herausforderung umgehen. Eine überragende Rolle spielt hierbei wie in vielen anderen Bereichen auch die digitale Transformation. Grundsätzlich haben Betriebe mehr Möglichkeiten als je zuvor, große Datenmengen zu sammeln, zu analysieren und für den eigenen Geschäftserfolg nutzbar zu machen. Unternehmen können dank moderner Datenanalyse-Werkzeuge und der Künstlichen Intelligenz (KI) ihre CSR-Maßnahmen zunehmend besser planen und umsetzen und deren Effektivität messen:
Reporting-Tools: Wie geht Ihr Unternehmen mit Ressourcen um, etwa in Hinblick auf Emissionen und den Wasserverbrauch? Welche Erfolge konnten die bisherigen CSR-Initiativen bewirken? Dank digitaler Tools für die CSR-Berichterstattung können Sie Ihren Stakeholdern solche Informationen transparent vorlegen.
Blockchain: Einer der zentralen Aspekte der CSR ist die Rückverfolgbarkeit, etwa in Bezug auf die Lieferketten. Die Blockchain schafft hierfür die technologischen Voraussetzungen und macht Lieferketten transparenter und überprüfbar. Als Vorteil erweist sich hierbei auch die manipulationssichere Speicherung der Informationen.
Vorhersageanalyse: KI-gestützte prädikative Analysen helfen zum Beispiel dabei, Umweltrisiken besser abzuschätzen. Eine Stärkung der CSR in diesem Bereich bedeutet dann, negative Auswirkungen auf das Unternehmen und die Gesellschaft zu minimieren. Die Vorhersageanalyse eröffnet hier zumindest innerhalb gewisser Grenzen einen Blick in die Zukunft.
Mitarbeiter-Engagement-Programme: Organisationen können mit solchen Programmen erreichen, dass sich ihre Mitarbeiter stärker für soziale Projekte einsetzen. Dazu gehört auch die Teilnahme an Umweltinitiativen oder das Volunteering. Damit lässt sich das CSR-Bewusstsein der Belegschaft insgesamt stärken.
Wie entwickelt sich die Rolle der CSR in den kommenden Jahren weiter?
Es ist davon auszugehen, dass die Bedeutung der CSR in der Zukunft noch zunimmt und damit eine zentralere Rolle in der Strategie spielen sollte. Unternehmen sehen sich einem wachsenden Druck seitens ihrer Stakeholder ausgesetzt. Zu nennen sind hier neben Regierungen auch Kunden, Mitarbeiter und Investoren. CSR soll nicht nur das Image aufbessern und eine reine Marketingmaßnahme bleiben. Vielmehr dürften die Betroffenen sie zunehmend als zentralen Bestandteil der Unternehmensführung ansehen. Das ist klar erkennbar an Entwicklungen wie dem Lieferkettengesetz. Es findet ein Wandel von einem freiwilligen Engagement für soziale Themen hin zu einer rechtlichen Verpflichtung statt. Das gilt gerade für große Unternehmen, weil für kleinere Firmen bisher noch Ausnahmereglungen existieren. Doch es ist davon auszugehen, dass letztlich jede Form der unternehmerischen Tätigkeit davon betroffen sein dürfte. Fragestellungen bezüglich der Inklusion, Diversität und sozialen Gerechtigkeit dürften für alle stärker in den Vordergrund rücken. Niemand wird sich der Herausforderung entziehen können, Benachteiligungen in seinem Betrieb abzubauen und sein Geschäft noch konsequenter unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes auszurichten.
Fazit
Wer CSR bisher sozusagen als freiwillige Leistung angesehen hat, muss sich in den kommenden Jahren vermutlich deutlich umstellen. Verbraucher, Gesetzgeber und natürlich auch die eigenen Mitarbeiter sowie die Eigentümer üben zunehmend Druck aus und fordern, dass Unternehmen soziale Verantwortung übernehmen. Setzt Ihr Betrieb bereits auf die Kreislaufwirtschaft, richten Sie den Fokus auf soziale Innovationen und nachhaltige Handlungsweisen? Im Idealfall machen Sie CSR zu einem Kernbestandteil Ihrer Unternehmenskultur. Dann fällt es leichter, mit dem gesellschaftlichen Wandel Schritt zu halten und eine verantwortungsvolle Unternehmensführung als Wettbewerbsvorteil auszugestalten. Es ist davon auszugehen, dass dabei ein enger Zusammenhang mit der digitalen Transformation besteht. Denn viele Anforderungen an die CSR lassen sich nur erfüllen, wenn Sie auf zukunftsweisende Technologien setzen und Daten effizient verarbeiten können. So gelingt es Unternehmen am ehesten, die Bedürfnisse von Umwelt und Gesellschaft gleichermaßen zu erfüllen.
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie gerne Ihre nächstgelegene HSP-Kanzlei an.
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns gerne an.